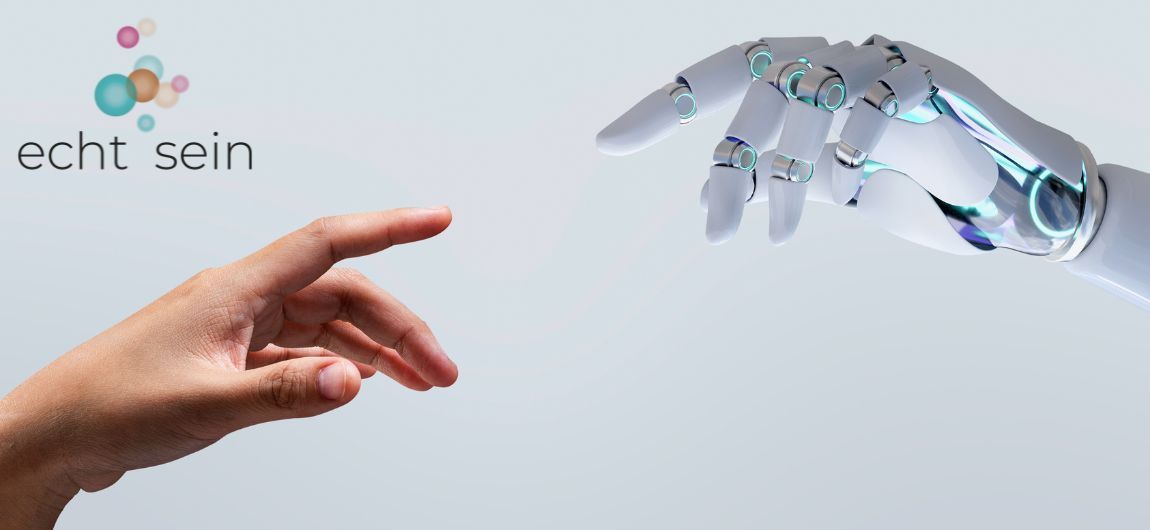Was tun gegen Flurfunk, Klatsch und Tratsch? Teil 3: Konstruktives Schimpfen
Wer weg guckt macht mit! Mit Gewaltfreier Kommunikation Haltung zeigen
Klatsch in der Teeküche, unterschwellige Kritik an Kolleg:innen oder Ärger über Vorgesetzte sind Teil des beruflichen Alltags. Im Rahmen meiner Auftragsklärung mit Teams höre ich fast jedes Mal „Bei uns wird so viel hintenrum geredet“. Offenbar ist das weit verbreitet, doch nicht alle fühlen sich damit wohl.
Ganz im Gegenteil, denn
- wahrscheinlich wird auch über mich gesprochen, sobald ich nicht im Raum bin
- Ich werde inhaltlich von meiner Arbeit abgehalten – und emotional mit Frust, Druck und Negativität konfrontiert
- Und das meist ohne gefragt worden zu sein
So geraten wir oft ungewollt in diese Dynamik. Manchmal aus Höflichkeit, manchmal aus Unsicherheit oder um Harmonie und Zugehörigkeit nicht zu gefährden.
Die Frage ist: Wie kann ich damit umgehen, ohne mich selbst zu verlieren und idealerweise trotzdem in Verbindung zu bleiben.
Ihr ahnt es sicher schon: Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) bietet dafür konkrete und alltagstaugliche Ansätze. Sie hilft, auch in herausfordernden Situationen empathisch, klar und handlungsfähig zu bleiben. Und ganz ehrlich: Mitten im Tratsch zu landen ist genau das: Eine echte Herausforderung.
Was tun, wenn getratscht und gelästert wird?
Zwei Kolleg:innen empören sich über eine andere Person, ein Ereignis oder eine Entscheidung im Unternehmen. Noch bevor du dich versiehst, bist du Teil des Gesprächs und stehst vor einer Entscheidung: Mitmachen, schweigen oder Haltung zeigen?
Die Perspektive der GFK:
GFK lädt dich ein, nicht automatisch in die gewohnte Dynamik einzusteigen, sondern kurz innezuhalten – und erst einmal bei dir selbst anzukommen:
- Was passiert gerade in mir? Was brauche ich?
Vielleicht ist es der Wunsch nach Respekt, Klarheit oder Zugehörigkeit. Unangenehme
Gefühle sind oft Hinweise auf unerfüllte Bedürfnisse. Fühlst du dich überfordert, genervt,
vielleicht auch unsicher, wie du reagieren sollst?
GFK lässt sich in Kurzform so zusammenfassen:
Was ist in mir los und was brauche ich? Was ist in dir los und was brauchst du? Und was machen wir jetzt damit? Was könnte ein nächster Schritt sein? Also:
- Was könnte beim Gegenüber los sein?
Oft drücken Menschen ihre Unsicherheiten oder Sorgen im Tratsch aus, ohne dies offen zu zeigen. Selten werden die direkt benannt. Wenn jemand sagt: „Na, ob die neue Kollegin das lange durchhält…“ – dann steckt oft Unsicherheit oder der Wunsch nach Stabilität oder Entlastung dahinter. Übersetze das, was du hörst, in mögliche Bedürfnisse der anderen Person, z. B. nach Klarheit, Verlässlichkeit oder Entlastung.
- Wie möchte ich reagieren?
Statt dich emotional hineinziehen zu lassen, lenke den Fokus auf mögliche Lösungen oder
nächste Schritte. Oder du kannst freundlich, aber klar signalisieren, dass du dich an
solchen Gesprächen nicht beteiligen möchtest.
Mögliche Reaktionen:
Szenario 1: „Findest du nicht auch, dass die Chefin total unfair ist? Das ist echt das Letzte!“
„Mir ist Fairness auch wichtig. Gleichzeitig weiß ich zu wenig über die Hintergründe – weißt du mehr darüber? Wenn nicht: Wäre das ein Thema fürs nächste Meeting?“
Oder:
„Klingt, als würde dich die Entscheidung ziemlich beschäftigen. Was genau würdest du dir von Frau X wünschen?“
Oder:
„Ich merke grade, dass das für mich nach Lästern klingt. Damit fühle ich mich nicht wohl. Wollen wir mal überlegen, wie wir Herrn Y direkt drauf ansprechen können?“
Szenario 2:
„Ich hab’ schon immer gewusst, dass die nicht ehrlich ist! Jetzt hat die sich schon wieder krank schreiben lassen, dabei ist die kerngesund!“
„Klingt, als wärst du enttäuscht. Wünschst dir mehr Verlässlichkeit im Team?“
Oder
„Bist du sauer, weil es eh schon zu viel Arbeit ist und jetzt noch mehr an dir hängt? Brauchst du Unterstützung?“
So entsteht Raum für Austausch – jenseits von Vorwürfen oder Pauschalurteilen.
Zwei Arten von Klatsch – und warum das wichtig ist
Nicht jeder Klatsch ist gleich. Ich unterscheide zwischen zwei sehr unterschiedlichen Formen und genau dieser Unterschied ist entscheidend für deinen Umgang damit:
- Urteilender Klatsch:
Hier geht es meist darum, andere abzuwerten, sich selbst aufzuwerten oder informell Normen durchzusetzen. Das geschieht oft subtil – ist aber auf Dauer destruktiv. Für Beziehungen. Für Teams. Für die Kultur. Für dich.
- Verarbeitender Klatsch:
In dieser Form nutzen Menschen Gespräche, um ihre Eindrücke zu sortieren, sich zu entlasten oder zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Hierin steckt eine wichtige soziale Funktion, wenn es respektvoll geschieht.
Ob du dich auf ein Gespräch einlassen möchtest, hängt also stark davon ab, welche Intention dahintersteht – und wie du reagieren kannst, ohne dich selbst zu verlieren.
Wenn du merkst, dass Klatsch eher Ausdruck von Unsicherheit, Frust oder Ohnmacht ist, kann ein empathisches Gegenüber unglaublich viel bewirken. Und: Es lohnt sich, das als Team einmal gemeinsam zu reflektieren. Zum Beispiel mit der folgenden Übung.
Übung: Konstruktiv schimpfen
Diese Übung gibt Teammitgliedern Raum, sich über belastende Themen zu äußern, ohne dass die Stimmung kippt oder Konflikte sich verhärten.
Sie ist schnell durchführbar, entlastend und schafft eine gute Basis für konstruktives Weiterarbeiten. Ideal zu Beginn eines Workshops oder wenn Spannungen spürbar sind.
So geht’s:
1. Zweierpaare bilden
Falls es Spannungen gibt, gern parteiübergreifend. Das fördert Perspektivwechsel.
2. Rausgehen & reden
Jedes Paar spaziert gemeinsam eine kleine Runde an der frischen Luft. Bewegung erleichtert den Austausch.
- Person A spricht 5 Minuten ungestört über das, was sie in der Zusammenarbeit besonders frustriert, irritiert oder ärgert.
- Person B hört aufmerksam zu, unterbricht nicht, fragt nur bei Pausen: „Was noch?“ und notiert, welche Themen sie raushört, die Klärung brauchen.
- Nach 5 Minuten wird gewechselt.
3. Fokussieren
Die Paare stellen sich gegenseitig die Frage: „Was möchtest du jetzt erreichen? Was willst du angehen?“
4. Anliegen sichtbar machen
Jede:r schreibt das Wichtigste auf ein Post-it.
5. Gemeinsames Bild schaffen
Die Post-its werden nacheinander vorgelesen und auf einem Flipchart gesammelt. Dann: sortieren, priorisieren und gemeinsam überlegen, wie nächste Schritte aussehen können. Gerne regelmäßig wiederholen!
Was diese Übung bewirkt
- Alle konnten offen sprechen und wurden gehört.
- Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche werden sichtbar.
- Es wird eine gemeinsames Verständnis als Grundlage für Lösungen geschaffen
Es wird also nicht nur geschimpft, sondern es entsteht Klarheit, Richtung und Verbindung.
Fazit: Verbindung statt Verstrickung
Klatsch und Beschwerden gehören zum Arbeitsalltag, aber sie müssen nicht destruktiv sein. Sich davon abzugrenzen ist nicht immer leicht. Es braucht Klarheit, Mut und Haltung. Doch genau darin liegt auch eine Chance:
Mit Empathie und Bewusstheit können wir in schwierigen Gesprächen Verbindung schaffen, statt uns in alten Mustern zu verstricken.
Die Gewaltfreie Kommunikation bietet dafür alltagstaugliche Werkzeuge – ob im direkten Gespräch, in Meetings oder bei Teamprozessen. Sie hilft uns, handlungsfähig zu bleiben – und menschlich.
Beobachte dich selbst in der nächsten Woche: Wo nimmst du subtilen Klatsch wahr? Und wo bist du vielleicht selbst Teil davon? Willst du Teil davon sein? Allein diese Aufmerksamkeit kann schon etwas verändern.